Naturidylle trifft auf Kunst


Dorf der Spielzeugmacher: Wanderführer Willi Leibling begleitet Autor Oliver Gerhardt auf den Reicheltberg bei Seiffen.
Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbHAbsolute Wanderidylle
Als wir uns in der Saigerhütte Grünthal treffen, hallen plötzlich dumpfe, rhythmische Schläge über die Anlage des historischen Hüttenwerks aus dem 16. Jahrhundert. Der Boden scheint leicht zu beben. Kein Wunder, denn im ältesten funktionstüchtigen Kupferhammerwerk des Landes schlagen mehr als 300 Kilo auf den Amboss. Der Althammer ist das Highlight bei einer Führung über das Gelände mit über 20 Gebäuden, das zum Weltkulturerbe gehört. In einem damals geheimen Verfahren wurde aus sogenanntem Schwarzkupfer das Silber herausgelöst. „Das Grünthaler Dachkupfer war in ganz Europa begehrt“, erklärt der Guide. „Man verwendete es zum Beispiel für den Petersdom in Rom, den Reichstag und die Dresdner Frauenkirche.“ Die für die Verhüttung abgeholzten Wälder ersetzte man mit Fichten – Grundlage für die heutige Vegetation. Ich drücke noch einen Kammwegstempel in mein Tourenbuch, dann brechen wir auf. Es geht über das Flüsschen Flöha und auf einem steilen Sträßchen hinauf zur Kirche von Oberneuschönberg mit ihrem riesigen Schieferdach. Blühender Flieder beugt sich weit über eine morsche Feldsteinmauer, darunter wuchern weiß blühendes Hornkraut und Butterblumen. Ein Geheim tipp ist der kurze Abstecher über einen idyllischen Wiesenweg zu einem versteckt liegen den Aussichtspunkt am „Hexenplatz“, den der Pfarrer der Gemeinde angelegt hat: mit einer „Kusshaltestelle“ und einer Holzbank, von der aus man über die Windungen der Flöha bis nach Tschechien blickt. Über den Hüttengrund geht es dann weiter durch das Dorf mit seinen am Steilhang kleben den Gärten. Hier haben heute die Katzen wohl Ausgang: Eine graue lugt aus einem Feld, eine gescheckte liegt quer über der Straße, eine schwarze flüchtet ins Haus. Wir folgen dem Sagenweg „Hüttenmatths“, der teilweise parallel zum Kammweg verläuft. „Diese uralte Geschichte handelt vom Hammerverwalter Matthes, der einen Pakt mit dem Teufel schloss und dann alles daransetzte, sich daraus zu befreien“, erklärt Drechsel. An elf Stationen haben Künstler die Sage mit Skulpturen aus Holz, Edelstahl und Glas in Szene gesetzt. Dass diese Landschaft reich an Mythen und Legenden ist, überrascht kaum: Seit Jahrhunderten leben die Menschen hier in enger Verbindung mit dem Wald, dessen Rohstoffe sie zunächst für den Bergbau, später auch die Glasherstellung und das Handwerk nutzten. Alte Flur und Wegenamen wie Dürrer Holzweg und Buttermilchweg, Kalter Kober und Alter Köhlerweg zeugen von dieser Geschichte. Am Tiefen Graben, wo ein Bach ins Tal hinabplätschert, verabschiede ich mich von Matthias Drechsel und nehme die vierte Etappe des Kammwegs in Angriff. Die Fichten haben hier einen Hallenwald wie ein grünes Kirchenschiff gebildet. Ihre Nadeln federn als weicher Teppich unter den Füßen und verschlucken jedes Geräusch. Dafür sorgen Vögel wie die Singdrossel und der Waldlaubsänger für Musik. In Hirschberg überquere ich noch einmal die Flöha, dann verschluckt mich erneut der dichte Wald. Kurz vor Seiffen, am Rande einer gelb blühenden Wiese, kniet gerade eine Frau im Gras und pflückt Butterblumen in einen kleinen roten Eimer. „Ich stelle daraus heilende Cremes gegen Wunden und Ekzeme für meine Pferde her“, erklärt mir Lenka Zmeskalova. „Viele Produkte, die sonst verkauft werden, sind doch voller Chemie.“ Das Dorf Seiffen zählt aufgrund seiner Holzkunst zu den traditionsreichsten im Erzgebirge. Seit dem 17. Jahrhundert stellen die Bewohner in liebevoller Handarbeit Nussknacker, Spielzeug, Weihnachtspyramiden und Schwibbögen her. Die Geschäfte in der Hauptstraße haben alle ihre eigene Nische gefunden – von Miniaturen in der Zündholzschachtel bis hin zu Donald Trump oder Erich Honecker als Holzfigur. Insbesondere in der Weihnachtszeit zieht Seiffen viele Besucher an, die den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, das tägliche Öffnen des „Weihnachtstürchens“ und den Laternenumzug an Heiligabend erleben möchten. Im Mittelpunkt des Geschehens steht dann die berühmte Bergkirche, die nach dem Vorbild der Dresdner Frauenkirche errichtet wurde. Pünktlich um zwölf Uhr erreiche ich das Gotteshaus zur Führung mit Michael Harzer. Der Pfarrer zeigt seinen Gästen die symbolträchtigen Details der Kirche, darunter die acht Säulen, die für das Göttliche stehen, und das Kreuz aus Zinn – das Material, dem Seiffen seine Entstehung verdankt. Zum Abschluss spielt Harzer auf der historischen Orgel ein Sommerlied und lässt den Zimbelstern erklingen. Am nächsten Morgen breche ich mit Willi Leibling zu einer Tour rund um die 2000EinwohnerGemeinde auf. Die Holzkunst habe im Ort immer für Wohlstand gesorgt, erzählt der 68jährige Wanderführer, während wir einen Aussichtspunkt auf dem 715 Meter hohen Reicheltberg ansteuern. Entgegenkommende Wanderer rufen uns ein fröhliches „Glück auf“ entgegen, der traditionelle Gruß im Erzgebirge. Leibling erzählt Anekdoten aus dem Alltag der Einheimischen: „Wenn wir zu DDR-Zeiten in den Urlaub fuhren, hatten wir immer etwas ‚Seiffener Währung‘ im Kofferraum: Pyramiden, Nussknacker, Räuchermänner. Man konnte da mit die Reisekasse aufbessern oder sie gegen Sachen tauschen, die schwer zu haben waren, wie Reparaturleistungen oder Ersatzteile.“ Auch während der Pandemie boomte der Handel mit Holzkunst, sagt der Guide: „Der Renner war eine Figur von Virologe Christian Drosten – dabei war das nur als Jux gedacht.“

Bunter Flickenteppich aus Landschaften am Fuß des Schwartenbergs.
Oliver Gerhardt
Lebensgrundlage Holzkunst
Dann erkunden wir die „Binge Geyerin“, ein Relikt aus Bergbauzeiten: Mitten im Ort führt ein schmaler Pfad an einem senkrechten Abgrund entlang. In der Tiefe erstreckt sich grüne Wildnis, aus der Kinderstimmen heraufschallen. Alle paar Meter eröffnen sich neue Blicke über Seiffen, die Bergkirche und die umliegende Landschaft. „Solche Bingen sind durch Untergrabungen und Einstürze entstanden“, erklärt der Guide, während wir in einen Felsenkessel eintauchen. „Einst hatten hier rund 40 Familien eine Lizenz zum Schürfen. Sie legten Feuer an den Wänden und löschten es dann mit kaltem Wasser, um das Gestein mürbe zu machen – eine Methode, die dem Sprengen mit Dynamit vorausging.“ Bis heute erstreckt sich hier ein Netz aus Stollen und Tunneln aus dieser Zeit. Erst nach dem Ende des Bergbaus entdeckten die Seiffener in der Holzkunst eine neue Lebensgrundlage – sie wurde zur Quelle des heutigen Wohlstands. Wenn keine Feldarbeit anstand, saß die ganze Familie in der Stube und fertigte Holzspielzeug. Einen lebendigen Eindruck vom Leben jener Zeit vermittelt das Freilichtmuseum Seiffen, in dem sich 15 historische Häuser an einen Hang schmiegen, darunter auch die Werkstatt von Dirk Weber. „Meine Ausbildung als Reifendreher begann hier 1984“, erzählt der Handwerksmeister. „Damals ergriff noch rund die Hälfte der Schulabgänger den Beruf des Spielzeugmachers.“ Heute ist Weber einer der letzten seines Fachs. Er spannt eine runde Scheibe aus Fichten holz in die Drehbank, die sich ratternd in Gang setzt, dann schabt er konzentriert mit einem langen Eisen in das weiche Holz. Lange Spanfetzen fliegen durch die Luft. Allmählich werden erste Formen sichtbar: „Ich beginne mit den Füßen der kleinen Holztiere“, sagt Weber. Erst als der Reifen fertig ist und der Meister ihn spaltet, erkennen wir, dass er kleine Elefanten gedreht hat. Es ist eine Arbeit, der viel Gefühl und Routine verlangt. Bis zu 140 Holztiere kann er aus einem einzigen Reifen gewinnen – einst ein Vorläufer der Massenproduktion. Inmitten der historischen Bauten fällt ein weiß schimmerndes Kunstwerk ins Auge: die Skulptur „Twister Again“ der amerikanischen Bildhauerin Alice Aycock. „Kinder sehen darin einen Wind, der um die Ecke braust“, erklärt der Museumskurator. Mich erinnert sie an die wirbelnden Holzspäne in Dirk Webers Werkstatt – eine Hommage an die Kunstfertigkeit der Erzgebirgsbewohner und eine poetische Verbindung zwischen Tradition und Moderne.Mehr inspirierende Reportagen, Produkttests und Wissenswertest aus unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt gibt es im Wanderlust-Abo! 6 x im Jahr.


Wandern
Wandertipps
KAMMWEG Der Kammweg Erzgebirge-Vogtland führt in 17 Etappen über 288 Kilometer und 6000 Höhenmeter von Geising/Altenberg im Osterzgebirge bis Blankenstein in Thüringen. An der Strecke liegen viele Stätten des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Während der Saison von Mai bis Oktober kann man auf der App Summitlynx Streckenpunkte für eine digitale Wandernadel sammeln. Der Tourismusverband Erzgebirge bietet mehrere Pauschalen zum Erwandern des Kammwegs – auch mit Gepäcktransport. kammweg.de, erzgebirge-tourismus.de

Schön und köstlich: die Schwartenbergbaude
Oliver GerhardtRegionales Essen genießen
Schwartenbergbaude
Der Erzgebirgsverein errichtete diese urige Hütte 1927 auf dem Gipfel des Schwartenbergs. Es gibt deftige Hausmannskost, aber auch Salate – ideal für die Einkehr am Kammweg. Mo.–Fr. 11–17, Sa./So. bis 20 Uhr,schwartenbergbaude.de
Buntes Haus
Im Zentrum von Seiffen nahe der Berg kirche liegt das Gasthaus und Hotel Buntes Haus mit hervorragender Küche und gemütlichen Zimmern, die als Teil einer Kammweg-Pauschale buchbar sind. Täglich 7–21 Uhr,
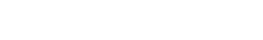
_352x352_crop.webp)







_649x365.webp)
